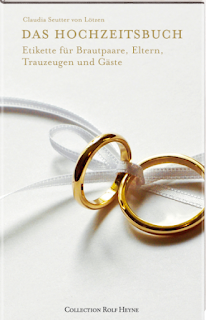Die blitzgescheite Autorin des vorliegenden Buches - Dr. Helene Karmasin- hat ein überaus eloquentes Buch über unterschiedliche Körperkonzepte verfasst, das ich mit viel Interesse gelesen habe.
In ihrem Buch bindet sie unzählige sehr gelungene Zusammenfassungen der geistigen Leistungen von Personen wie René Descartes, (französischer Philosoph , 1596- 1650) Mary Douglas, (englische Sozialanthropologin, 1921-2007), Norbert Elias, (Soziologe, 1897-1990) Michel Foucault, (französischer Philosoph, 1926-1984), Christoph Wilhelm Hufeland, (Deutscher Arzt und Gelehrter, 1762-1836), Adam Smith, (Schottischer Moralphilosoph und Begründer der Nationalökonomie, 1723-1790), Emile Durkheim, (französische Soziologe und Ethnologe, 1858-1917), Pierre Bourdieu, (französischer Soziologe, 1930-2002) u.a. mehr ein. Dass die Autorin die Vorstellungen dieser Denker kurz skizziert, hat natürlich einen guten Grund. All diese Personen spielen bei der Entwicklung von Körperkonzepten eine Rolle, wie der Leser im Laufe der Lektüre zu begreifen lernt.
Körperkonzepte beschreiben, auf welche Weise Körper zu "denken" sind, was man unter einem Körper zu verstehen hat, auf welche Art er funktioniert, aus welchen Teilen und Instanzen er zusammengesetzt ist etc.. Es geht also um Modellvorstellungen von Körpern. Empirisch sind diese Vorstellungen nicht nachprüfbar und sie entsprechen auch nicht einer medizinischen Denkweise, vielmehr sind es soziale und kulturelle Vorstellungen, die von vielen geteilt werden und eine lange Geschichte haben, (vgl.: S.17). Dr. Karmasin nennt zunächst das dualistische und das ganzheitliche Modell und arbeitet anhand von einer Tabelle die Unterschiede der beiden Modelle heraus. Es stellt sich die Frage wie der Körper zu denken ist, wer oder was dominiert, beispielsweise Seele oder Körper. Bilden Seele und Körper einen Gegensatz oder eher eine Einheit? Welche Merkmale kommen dem Körper, welche der Seele oder dem Geist zu?
Im dualistischen Konzept ist der Geist der Herrscher des Körpers. Descartes hat dieses Konzept am eindrucksvollsten beschrieben. Darüber liest man in der Folge ausführlich und erfährt, dass dieses Konzept der Leibesfeindlichkeit bereits von den antiken Philosophen entwickelt worden ist. Dieses Konzept, das heute immer noch zum Tragen kommt, führt dazu, dass Personen, die diesem Identitätskonzept nachhängen, meinen, aus einer inneren Person und einem äußerlich sichtbaren Körper zu bestehen. Der Körper ist in diesem Fall das Gefängnis der Seele, (vgl.: S.30). Das Gegenmodell bildet das ganzheitliche Konzept, das den Körper als Einheit begreift. Um Körpervorstellungen wirklich verstehen zu können, muss man sich ferner mit der Vorstellung des geschlossenen und offenen Körpers befassen. Was damit gemeint ist, erläutert die Autorin gut nachvollziehbar, (vgl. S.37 ff).
Im Rahmen der Thematisierung der Herkunft unserer Körperkonzepte, wird dem Leser der zivilisierte und auch der disziplinierte Körper, sowie der Körper des aufgeklärten Bürgers entgegengebracht und der Vitalismus sowie biotechnische/hybride Körper beleuchtet. In diesem Zusammenhang erfährt man u.a. , dass der zivilisierte Körper ein perfekt geschlossener, glatter Raum sei, bei dem jedes Anzeichen einer als tierisch gedachten Natur entfernt sei. Dieses Körperkonzept charakterisiert den Anfang der Neuzeit, (vgl.: S.44-45). Der disziplinierte Körper (das dahinterstehende Konzept steht mit M. Foucault in Verbindung) ist ein kontrollierter, bewachter Körper, der Leistungen erbringen soll. Hingegen ist der Körper des aufgeklärten Bürgers ein solcher, der den Wertvorstellungen der Bürger im 19. Jahrhundert entsprach und sich auf Mäßigung, Harmonie und disziplinierte Stellung in der Mitte berief und sich abgegrenzte gegen die triebhaften Unterschichten und den lasterhaften Adel. Beim Weiterlesen wird immer klarer, dass jedes Jahrhundert sein eigenes Körperkonzept entwickelte, das sich aus soziologischen, philosophischen, wirtschaftlichen, politischen, medizinischen und vielen anderen Bedingungen ergeben hat.
In dem Kapitel Funktionsmodelle, wird erläutert, wie der Körper funktioniert und wie der Einfluss der Kultur auf den Körper gemessen wird. Die Funktionsmodelle des Körpers unterscheiden sich erheblich in der individualistischen, der hierarchischen, der egalitären und der fatalistischen Kultur. In hierarchischen Kulturen wird der Körper dem Diktat von Autoritäten unterworfen, die u.a. Behandlungen vorschreiben und Verhalten erzwingen, während beispielweise in individualistischen Kulturen man sich selbst für den Zustand seines Körpers verantwortlich fühlt und sich Kenntnisse aneignet, um den optimalen Körper zu erzielen, (vgl.:S. 100-101). Individualisten gehen wohl am eigenständigsten mit ihrem Körper um und versuchen ihn am nachhaltigsten gesund zu erhalten.
Dr. Karmasin thematisiert auch den Körper in der Markt- und Mediengesellschaft, in der Leistungsfähigkeit, die durch Gesundheit gewährleistet wird und eine perfekte Oberfläche (Jugendlichkeit und Makellosigkeit) erwartet werden. Wir müssen vital, jung, makellos, schlank, gesund, beweglich, leistungsfähig, jederzeit einsatzbereit, belastbar, zivilisiert und diszipliniert sein, wenn wir den geforderten Vorgaben entsprechen wollen, (vgl.: S.114).
Dicke Menschen werden in unserer Gesellschaft nachweisbar diskriminiert. Sie fungieren als "cultural criminals", die durch ihre Abweichung wie Sünder und Verbrecher verdeutlichen, was das geforderte Verhalten der Vernünftigen und moralisch Guten sei, (vgl.: S.115).
Die Autorin zeigt die enge Verbindung zwischen Körperkonzepten und politischen Vorstellungen auf, bringt selbst die Körper von Politikern zur Sprache, thematisiert breitgefächert den gesunden Körper, zeigt das Gesundheitsverhalten bei niedrigem und hohem sozioökonomischem Status und verdeutlicht, dass Gesundheit an eine spezifische Weltsicht gebunden ist.
Es folgt ein Aufzeigen von Möglichkeiten, wie man versucht, sich vor Krankheiten zu schützen und in welcher Weise die Werbung Argumente für Selbstmedikation liefert, damit wir täglich eine Hand voller bunter Pillen schlucken. Da wir aber nicht nur gesund, sondern auch schön sein wollen, stellt sich die Frage, welchen Körper wir wollen. Der Gewinn der Körpermodellierung ist beträchtlich, wie die Autorin hervorhebt, denn er verspricht Status, Prestige, mehr als alle anderen Prestigeobjekte, er führt zu sozialem Erfolg , korreliert mit geistiger Gesundheit und zeigt, dass die Person selbstbestimmt, diszipliniert und Herr ihrer Affekte ist, (vgl.: S.245).
Studien machen bewusst, dass physisch attraktive und schlanke Menschen von gewisser Körpergröße Personen mit weniger optimalen Vorgaben in vieler Hinsicht im Vorteil sind, (vgl.: S. 246).
Unser Körper ist heute ein Ausdruck für individuelle Disziplin und Leistungsfähigkeit. Wir werden in unserer Gesellschaft nach den derzeit gängigen Körpervorstellungen beurteilt und müssen sozialer Diskriminierung rechnen, wenn wir uns den Vorstellungen versagen. Das Buch macht deutlich, dass dies kein Phänomen dies Hier und Heute ist, sondern dass wahre Schönheitsvorstellungen immer gesellschaftlich geprägt waren und sich jede Gesellschaft den Körper schafft, den sie zum Funktionieren benötigt.
Empfehlenswert.
Bitte klicken Sie auf den Button, dann gelangen Sie zu Amazon und können das Buch bestellen.
--------------------------------------------------------------------------------